Depression statt Vaterglück

Mindestens jeder zehnte Vater entwickelt nach der Geburt seines Kindes Anzeichen einer Depression. Für die junge Familie ist wichtig, dass sich die Betroffenen früh behandeln lassen.
Viele Männer beschreiben die Geburt ihrer Kinder als die glücklichsten Momente ihres Lebens. Doch in der Folgezeit warten einschneidende Veränderungen auf die frischgebackenen Väter. Als Reaktion entwickeln manche Männer sogar eine Depression. „Typischerweise kommt es zu Erschöpfung, Antriebslosigkeit und einem Gefühl der Leere sowie auch Schlafstörungen, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen“, beschreibt Dr. Christa Roth-Sackenheim vom Berufsverband Deutscher Psychiater (BVDP). Weitere Symptome sind unbegründete Ängste sowie Minderwertigkeits- und Schuldgefühle. Oft entwickelt sich die Depression schleichend und tritt erst nach drei bis sechs Monaten deutlich zu Tage.
Ursachen der Depression
Vermutlich tragen die veränderten Lebensumstände entscheidend zur Krankheitsentstehung bei. Als Risikofaktoren nennt Dr. Roth-Sackenheim Depressionen in der Vorgeschichte, Partnerschaftsprobleme, finanzielle Schwierigkeiten oder überhöhte Erwartungen an die Vaterrolle. Zusätzlich verstärken Schlafmangel, Eifersucht und die Verantwortung den Druck auf die Väter. Das größte Risiko haben Männer, deren Frau ebenfalls an einer Wochenbettdepression erkrankt ist.
Betroffene Väter benötigen früh Hilfe
Ein erster wichtiger Schritt ist, dass der Betroffene seine Schwierigkeiten mit der Partnerin bespricht. Gemeinsam fällt es dem Elternpaar leichter, sich auf die Situation und die neuen Anforderungen einzustellen. „Bleiben depressive Symptome bestehen, sollten die Väter frühzeitig psychiatrisch-psychotherapeutische Unterstützung suchen“, empfiehlt Dr. Christa Roth-Sackenheim. Sonst leiden das Familienleben und die Entwicklung des Kindes. Im Idealfall bezieht die Therapie die gesamte Familie mit ein. „Den Vätern hilft es, sich stärker als Teil des Elternbündnisses zu erleben und auch Unsicherheit im Umgang mit dem Kind abzubauen“, erklärt die Psychiaterin.
Quelle: Neurologen und Psychiater im Netz



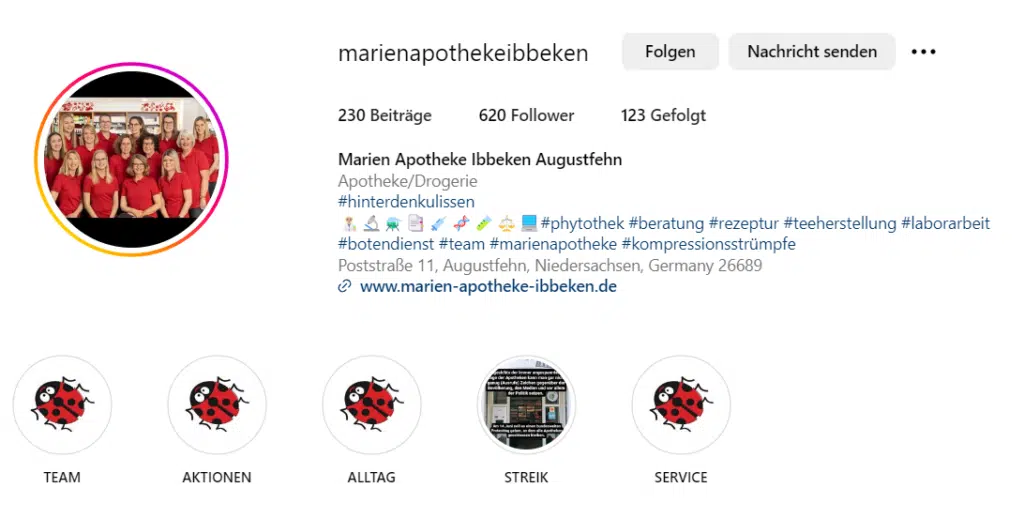
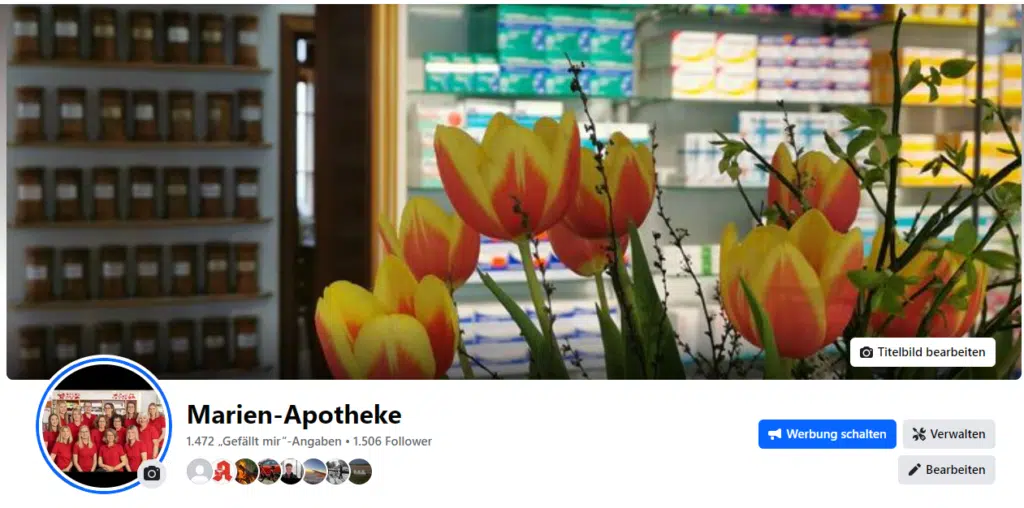
 LEADPEAK
LEADPEAK